Die Geschichte "Das verräterische Herz" wurde erstmals 1843 im Pioneer, einem Bostoner Magazin, veröffentlicht.
Mord ohne Motiv
In dieser Erzählung finden sich alle Elemente der Schauerliteratur auf engstem Raum: das unterschwellige Geheimnis, das unheimliche Gebäude (hier wird ein ganzes Schloss in einen einzigen Raum verwandelt, wir haben das schreckliche Verbrechen und das Oszillieren zwischen dem Übernatürlichen und dem Psychologischen). Auf nur fünf Seiten scheint es, als habe Edgar Allan Poe den Schauerroman des achtzehnten Jahrhunderts zu einer Geschichte von nur wenigen tausend Wörtern verdichtet. Doch was macht diese Geschichte so beunruhigend? Eine genauere Analyse zeigt, dass sich "Das verräterische Herz" auf das Beunruhigendste überhaupt konzentriert: den Mord ohne Motiv.
Der Herzschlag eines Toten
Ein namenloser Erzähler gesteht, dass er einen alten Mann ermordet hat, offensichtlich wegen des "bösen Auges" des alten Mannes, das den Erzähler dazu brachte, ihn zu töten. Dann beschreibt er, wie er sich in das Schlafzimmer des schlafenden alten Mannes geschlichen, ihn erstochen, die Leiche weggeschleift und zerstückelt hat, um sein Verbrechen zu vertuschen. Er unternimmt einige Anstrengungen, um alle Spuren des Mordes zu verwischen - er fängt sogar das Blut seines Opfers in einer Wanne auf, damit nirgendwo Blut verspritzt wird -, dann nimmt er drei der Bodenbretter des Zimmers und versteckt die Leiche seines Opfers darunter. Kaum hat er die Leiche versteckt, klopft es an der Tür: Es ist die Polizei, die von einem Nachbarn gerufen wurde, der in der Nacht einen Schrei gehört hatte. Der Erzähler lässt die Polizisten herein, um das Haus zu durchsuchen, und erzählt ihnen die Lüge, der alte Mann sei auf dem Land. Er bleibt ruhig, während er sie herumführt, bis sie sich in den Raum setzen, unter dem die Leiche des Opfers versteckt ist. Der Erzähler und die Polizisten unterhalten sich, doch nach und nach hört der Erzähler ein Geräusch in seinen Ohren, das immer lauter und eindringlicher wird. Er glaubt, es sei der Herzschlag des Toten, der ihn von jenseits des Grabes aus verspottet. Irgendwann hält er es nicht mehr aus und fordert die Polizei auf, die Dielen herauszureißen, denn der Herzschlag des alten Mannes drängt ihn, sein Verbrechen zu gestehen.
 |
| (c) theemptykissofdeath |
Der labile Erzähler
Der Erzähler von "Das verräterische Herz" ist eindeutig labil, wie das Ende der Geschichte zeigt, sein psychischer Zustand ist von Anfang an fragwürdig, wie die ruckartige Syntax seiner Erzählung vermuten lässt:











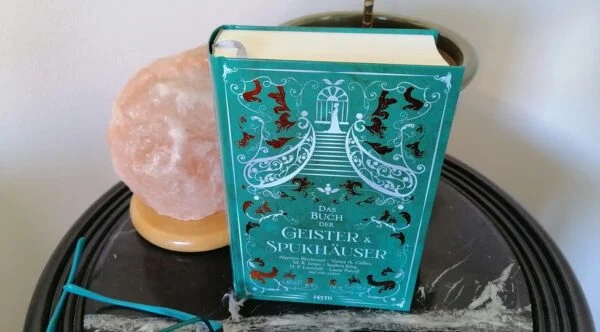














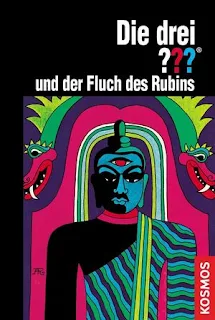


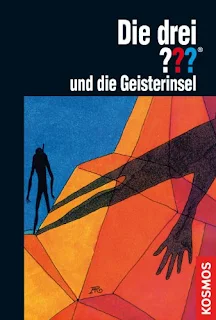


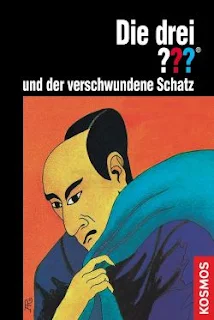
.jpg)


